Seemannssprache – Gedanken zur geheimen Sprache der Seeleute
Dieser Blogbeitrag handelt von einem Thema, das durchaus kontrovers ist – von der Seemannssprache. Es ist die Fachsprache, die Seeleute nutzen. Für Landratten ist sie mystisch und geheimnisvoll. Für Segelanfänger ist sie ein neues Universum, dass sie zu Beginn oft überfordert. Ich möchte dir meine Meinungen und Gedanken zu der Sprache der Seefahrt näherbringen. Dabei zeige ich, warum man sie zu einem bestimmten Grad beherrschen muss. Ich werde aber auch erklären, weshalb sie häufig überbewertet wird. Da es hier kein „richtig“ und kein „falsch“ gibt, nicht nur Schwarz und Weiß, bin ich auf deine Meinung in den Kommentaren gespannt. Und jetzt „Leinen los und hisst die Segel!“
Was ist die Seemannssprache und wo kommt sie her?

Die Seemannssprache stammt ursprünglich aus der kommerziellen Seefahrt und damit aus einer Segelschifffahrt, die es heute in der Form nicht mehr gibt. Damals war es auf Schiffen mit großer Crew notwendig, eine Sprache zu finden, die alle verstehen. Sie musste gleichzeitig spezifisch genug sein, um in kurzen Aussagen viel Inhalt zu vermitteln. Ein schönes Beispiel hierfür ist das „laufende Gut“, also die Leinen, die zum Bewegen der Segel dienen. All diese Leinen einzeln aufzuzählen würde zu lange dauern. Daher fand man diesen Oberbegriff, mit dem alle etwas anfangen können. Große, kommerzielle Segelschiffe hatten oft mehrere Masten mit vielen Segeln. Jedes dieser Segel wurde wiederum über mehrere Leinen bedient. Da war es wichtig, dass der Kapitän seiner Crew in wenigen Worten klarmachen konnte, was zu tun und welche Leine an welchem Segel an welchem Mast dichtzuholen (einholen) oder zu fieren (freigeben) ist.
Als ich zum ersten Mal ein Segelboot betrat, war ich überwältigt von der schieren Anzahl der verschiedenen Leinen und Taue. Am offensichtlichsten ist das bei Einhandseglern, bei dem die meisten Leinen über das Deck in das Cockpit geführt werden, um jederzeit griffbereit zu sein, ohne dass der Segler das Ruder verlassen muss. Seemannssprache findet man aber nicht nur bei den Leinen und Segeln. Sie erstreckt sich über alle Bereiche des Schiffs. Statt „hinten“ sagt man „achtern“, die „Pantry“ ist die Küche und „rechts“ heißt „Steuerbord“. Häufig stammen die Worte dabei aus dem Plattdeutschen. Das sieht man gut an Begriffen wie Pütz (ein Eimer mit einer Leine am Henkel) oder Tampen (die Enden einer Leine). Die Hanse hatte hierbei sicher einen großen Einfluss. Spricht man diese Wörter mit der richtigen Betonung aus, fühlt man sich schon fast wie ein Nordlicht.
Heute ist die kommerzielle Segelschifffahrt bis auf wenige touristische Ausnahmen verschwunden. Große Ozeanriesen werden von einer Hand voll Personen gesteuert. Damit verliert auch die Seemannssprache zunehmend ihre professionelle Bedeutung. Es gibt allerdings eine kleine Gruppe von Menschen (ein kleines Dorf, dass sich den Römern widersetzt), von denen sie weiterhin verwendet und gepflegt wird. Die Rede ist natürlich von den Sport- und Freizeitseglern. Bei ihnen hat die Seemannssprache eine neue kulturelle und gesellschaftliche Heimat gefunden. Wer als nicht-Segler oder Anfänger auf den Stegen im Hafen auf und ab geht, der merkt schnell, dass die Sprache dort mit Stolz benutzt wird.

Wann ist Seemannssprache notwendig und wann ist sie nützlich?
Lässt man Nostalgie und Kultur beiseite, ist der Jargon der Seeleute in der Bootsfahrt im Allgemeinen und im Segelsport im Speziellen wohl vor allem in der Ausbildung noch präsent. Dort begegnet man weiterhin Begriffen wie Stropp, Talje und Läufer und es ist nötig, diese zu verstehen und zu lernen. Meiner Erfahrung nach prägt man sich solche Wörter am besten in der Praxis ein. Daher legen die Skipper auf Ausbildungstörns auch so viel Wert darauf, die richtigen seemännischen Begriffe zu verwenden. Das kann für den Schüler am Anfang recht nervtötend sein, da er immer wieder nachfragen muss, was gemeint ist. Es hilft allerdings im theoretischen Teil der Prüfung zum Segelschein, da das Nachschlagen und Lernen der „Vokabeln“ entfällt. Man kann sich ganz auf die Inhalte der Theorie konzentrieren. Rückblickend würde ich daher jedem SBF- und SKS-Schüler empfehlen, erst Ausbildungstörns und Praxisprüfung zu absolvieren und sich dann der Theorie zuzuwenden. Das ist bei der Segelausbildung zwar ungewöhnlich, macht für mich im Nachhinein aber viel Sinn.
Nützlich ist das Beherrschen der Seemannssprache zudem, wenn man viel mit anderen Menschen aus der Seefahrt zu tun hat. Das kann im Hafen sein, aber auch beim Kaufen und Reparieren von Bootsgegenständen und -zubehör. Nutzt man beim Segelmacher oder im Ersatzteile-Shop am Hafen die gleiche Sprache, weiß jeder schnell, was gemeint ist. Wenn man sich entscheidet, mit einer fremden Crew zu segeln, ist es ebenfalls hilfreich, „die gleiche Sprache“ zu sprechen. So kann besser zusammengearbeitet werden und im Notfall, bei Sturm oder Havarie, werden Anweisungen zügig und zielgerichtet umgesetzt. Man merkt schon, die Seemannssprache erfüllt weiter ihren angedachten Zweck, nur eben im Freizeitbereich statt in der kommerziellen Seefahrt.
Wann ist es mit der Seemannssprache „zu viel des Guten“ und wie kann sie Spaß machen?
Jede Medaille hat zwei Seiten. Und so wird auch die Nutzung der Seemannssprache manchmal übertrieben. Das passiert meist dann, wenn ein erfahrener Seemann oder Skipper durch die Verwendung der Fachbegriffe mit seinem Wissen prahlt oder unerfahrene Crewmitglieder damit vorführt oder „klein macht“. Man muss als Skipper nicht Pütz sagen, wenn eine Crew aus Anfängern „Eimer“ besser versteht. Es bringt keinen Vorteil, wenn der erfahrene Rudergänger (Person, die gerade am Steuer ist) laut ruft, man solle das Vorliek durchsetzen, wenn daraufhin niemand weiß, was getan werden muss. Ganz bestimmt ignoriert man als Skipper auch kein Crewmitglied, das sagt, der „Strick am großen Segel“ sei gerade gerissen.
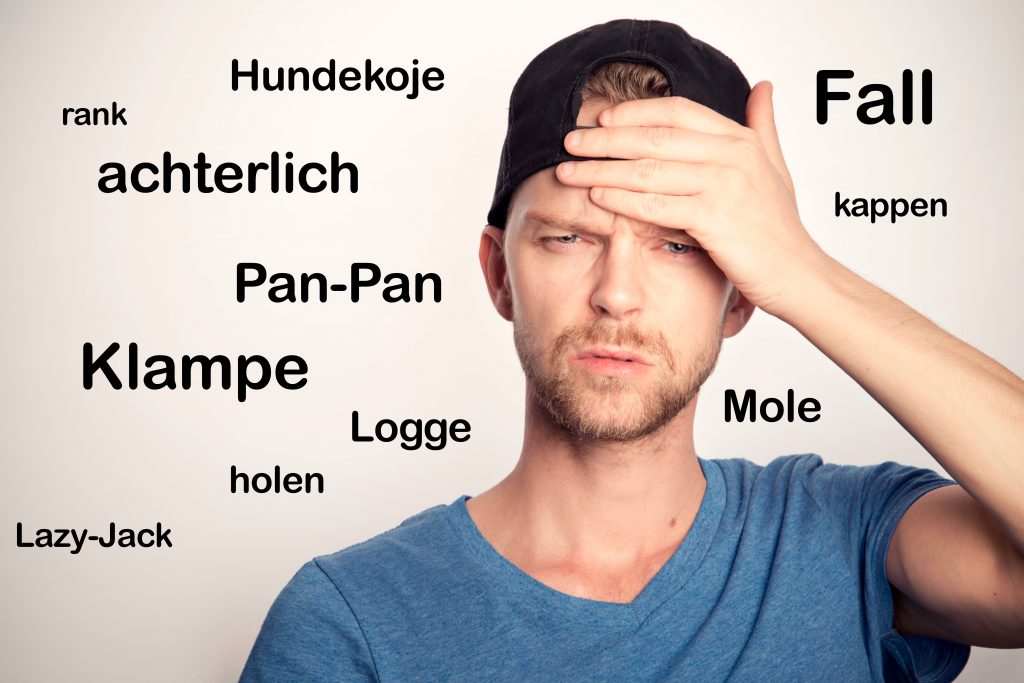
Meine Bitte und Empfehlung ist, die Seemannssprache zwar zu verwenden, aber so, dass alle etwas lernen und dabei Spaß haben. Erkläre deiner Crew die Begriffe vorher im Hafen. Reagiere nicht wütend oder genervt, wenn sie auch ein drittes Mal fragen, was mit dem ein oder anderen Wort gemeint ist. Feiere lieber gemeinsam mit der Crew, wenn die Bezeichnungen für die verschiedenen Leinen nach ein paar Tagen auf dem Wasser sitzen und ihr beim Anlegerbier wie von selbst in Seemannssprache über die Ereignisse des Tages diskutiert. Das sorgt für Spaß und gute Stimmung statt Frust und Ärger.
Tipp Nr. 1
Seemannssprache soll Spaß machen, nicht frustrieren.
Was bedeutet was? Eselsbrücken und Merksätze in der Seefahrt
Was ist zu tun, wenn man mit einem Fachbegriff der Seemannssprache konfrontiert ist, den man nicht kennt und gerade kein Seebär in der Nähe ist, den man fragen kann? Die einfachste Möglichkeit ist, zu googeln. Das Internet ist voll von Erklärungen und „Übersetzungen“ der seemännischen Fachbegriffe. Viele sind gut, einige nicht so sehr. Alleine Wikipedia hat eine Liste mit tausenden von Einträgen zum Jargon der Seefahrt. Diese findest du weiter unten in den Links. Dort finden sich auch Schätze wie „Muschkeule“, „Nantucket-Schlittenfahrt“ und „Kalte Eier“.
Hilfreich, um sich die wichtigsten Begriffe zu merken, sind Merksätze und Eselsbrücken. Das ist bei der Seefahrt nicht anders als in der Schule. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl guter Merksätze, die Segelanfängern helfen. Hier sind einige:
Kennst du noch andere Merksätze oder Eselsbrücken? Dann schreibe sie gerne in die Kommentare zu diesem Beitrag und teile sie mit mir und den anderen Lesern.
Tipp Nr. 2
Merksätze und Eselsbrücken helfen bei den wichtigsten seemännischen Begriffen.
Um es dir und den anderen Lesern des Blogs etwas leichter zu machen, die Begriffe zu verstehen, möchte ich auf dieser Internetseite selbst ein kleines Lexikon der Seemannssprache anlegen. Darin sollen die Fachbegriffe in den Blogbeiträgen verlinkt und kurz beschrieben werden. Wer beim Lesen der Beiträge über Wörter stolpert, die erklärt werden sollten, zu denen es aber noch keinen Lexikoneintrag gibt, kann diese per Kontaktformular melden. Ich sorge dann schnellstmöglich für eine Ergänzung. Für ein solches Lexikon gibt es einige gute Lösungen, ich habe mich aber noch nicht final entschieden. Daher bitte ich um ein wenig Geduld.
Lang lebe die Seemannssprache! Oder doch nicht?
Wie man in diesem Beitrag vielleicht merkt, bin ich hin- und hergerissen, ob ich die Seemannssprache himmelhoch loben oder als veraltet und nicht mehr relevant abtun soll. Beides wäre falsch, denn sie gehört zum Segelsport dazu und verdient es, gepflegt zu werden. Unter dem kulturellen Aspekt ist sie etwas Schönes und es macht Freude, sie zu benutzen. Sie ist aber längst nicht mehr so notwendig, wie es dir manche Skipper und alte Seebären vielleicht einreden wollen.
Die Seemannssprache sollte, meiner Meinung nach, in einem Maße genutzt werden, in dem sich alle an Bord wohlfühlen. Wer weiß, vielleicht werfen nach dem nächsten Segelurlaub alle Crewmitglieder mit seemännischen Fachbegriffen um sich, wenn sie über das erlebte berichten, philosophieren und diskutieren.
Damit haben wir das Ende dieses Beitrags erreicht. Welche Erfahrungen hast du mit der Seemannssprache gemacht? Nervt sie dich oder sprichst du sie fließend? Wenn du Lust hast, deine Meinung mit mir und der Community zu teilen, hinterlasse gern einen Kommentar unter diesem Artikel.
Ahoi und bis bald!
Links:
Liste seemännischer Fachwörter bei Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_seem%C3%A4nnischer_Fachw%C3%B6rter_(A_bis_M))







